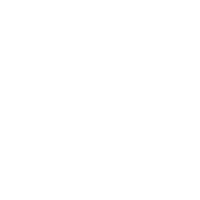Abendsonne
Ich verlasse den Wald und nehme den längeren Weg nach Hause. Der Wintertag geht zu Ende. Die Mondsichel im Geäst eines Baumes leuchtet in Blau der Dämmerung. Jeder Zweig, jedes flatternde Blatt hebt sich einsam hervor. Knoten. Knorren. Die Silhouette eines Vogels vor dem weißen Mondschein. Es ist zu kalt zum Singen.
Sie wissen nicht, wie weh sie mir tun. Der Baum, der Vogel. Die zerknitterten Blätter vom Vorjahr, die von den Zweigen hängen. Die Ehrlichkeit des nackten Daseins. Die Fragilität des Lebendigen und die Gewissheit des Vergangenen.
Warum gelingt es mir nicht, so zu leben? Letztlich zeigen wir uns alle in der Nacktheit unserer Gefühle. Wir wissen es nur nicht. Wie der Baum. Wie der Vogel, wie die sterbenden Blätter. Nur wir machen uns vor, unsere Sehnsüchte und Ängste verbergen zu können. Was uns vom Baum, vom Vogel unterscheidet, ist die Scham vor unseren wahren Begierden. Das Misstrauen der eigenen Bedürfnisse.
Wir sind aber so nackt wie der Baum. So sichtbar wie der zitternde Vogel, der hoffend auf Schutz sich vor der Kälte aufbauscht. So zerbrechlich wie die Blätter des letzten Sommers, die der leiseste Windstoß zum Fallen bringt.
Am Hauptplatz angekommen sehe ich, dass im Blumenladen noch Licht brennt. Ich kaufe mir einen Armvoll Rosen. Prächtige Blüten in sattem Altgold. Der Strauß ist schwer, denn die langen Stiele tragen dicke Dornen und viele dunkle Blätter. Ich wiege ihn wie ein Baby im Arm und bringe ihn zu mir nach Hause.
Auf dem Heimweg sehe ich zwei Frauen. Höre wie sie miteinander scherzen. Eine geht mit Stock. Sie halten an. So schöne Rosen! Was für eine Farbe! Verbringen Sie einen schönen Abend!
Ich bringe keine Worte hervor. Nur ungeweinte Tränen. Die Frauen lachen mich mit den Augen an. Eine berührt meine Schulter. Alles Gute! Sie wissen nichts vom Tod meines Vaters. Sie sind aber alt. Sie wissen vom Leben. Rosenblätter auf meine Wunde.